Unfallpräventation S-R-S Unfälle - Vorschriften und Regeln
Unfälle durch Stolpern, Rutschen oder Stürzen (sogenannte S-R-S-Unfälle) gehören zu den häufigsten Arbeitsunfällen. Mit zahlreichen negativen Folgen für die Betroffenen, wie auch die Unternehmen. Um solche Unfälle möglichst zu vermeiden oder die Gefahr so gering wie möglich zu halten, haben die Gesetzgeber der unterschiedlichen Länder, wie auch die Europäische Union, zahlreiche Vorschriften, Empfehlungen und Regeln erlassen und veröffentlicht. Wir informieren Sie auf den folgenden Seiten über alle wichtigen Aspekte der Regelungen und Vorschriften, sowohl national wie international.
Folgende Informationen haben wir für Sie zusammengestellt:
- Übersicht über die aktuelle Lage zu Arbeitsunfällen
- Bewertung der Rutschgefahr unter Betriebsbedingungen (inkl. Download)
- Regelungen für Antirutsch und Unfallprävention in Deutschland
- DGUV Regel 108-003 inkl. Download
- Pflichten für Arbeitgeber hinsichtlich Schutz vor Rutschunfällen (verbindlich)
- Unterschied zwischen DGUV Vorschriften und DGUV Regeln
- Internationale Vorschriften und Regeln (EU und Außer-EU)
- Beispiel (Frankreich)
- Messung und Messverfahren der Rutschhemmung in Deutschland
- Messung und Messverfahren International (EU, USA, UK)
- Links zu Regelwerken (Gesetze, Technische Regelwerke, BG-Vorschriften)
* Diese Informationen entsprechen keiner Rechtsberatung. Die Vorschriften und Gesetze unterliegen der regelmäßigen Aktualisierung. Wir garantieren nicht für die Aktualität der Informationen.

Statistik Arbeitsunfälle in Deutschland 2024
Jährlich veröffentlich die DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) einen aktuellen Jahresbericht über Arbeitsunfälle in Deutschland. Nach dem Bericht der DGUV aus dem Jahr 2024 stellen sogenannte "S-R-S-Unfälle" die zweithäufigste Unfallursache in deutschen Unternehmen dar.
156.314 Unfälle waren demnach in 2023 auf diese Ursache zurückzuführen!
21,9% aller Unfälle sind "SRS"-Unfälle (Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle)
Im Jahr 2023 entfielen etwa 21,9% aller Arbeitsunfälle in Deutschland auf Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle (SRS-Unfälle). Das macht SRS-Unfälle zur zweithäufigsten Ursache für Arbeitsunfälle. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) veröffentlicht jährlich Statistiken zu Arbeitsunfällen, die auch nach Ursachen aufgeschlüsselt sind.
Statistiken und Grafiken:
Die DGUV veröffentlicht jährlich einen Bericht zum "Unfallgeschehen", der auf Unfallanzeigen von Unternehmen basiert. Diese Statistiken sind valide, da Unternehmen meldepflichtige Unfälle (Verletzungen mit mindestens vier Tagen Arbeitsunfähigkeit) melden müssen. Die DGUV-Statistik weist aus, dass SRS-Unfälle im Jahr 2023 rund 21,9% aller Arbeitsunfälle ausmachten. Es gibt auch Grafiken und Factsheets, die spezifisch auf SRS-Unfälle eingehen, wie z.B. das Factsheet der DGUV. Diese Grafiken können die Entwicklung der SRS-Unfälle über die Jahre oder den Anteil an den Gesamtunfällen darstellen.
Ursachen und Folgen:
- SRS-Unfälle sind die zweithäufigste Unfallursache nach innerbetrieblichem Transport.
- Stolpern, Rutschen und Stürzen können zu verschiedenen Verletzungen führen, wie z.B. Knöchel- und Fußverletzungen.
- Diese Verletzungen können wiederum zu längeren Arbeitsausfällen führen.
- Daher ist es wichtig, Präventionsmaßnahmen zu ergreifen, um SRS-Unfälle zu vermeiden.
Zusammenfassend lässt sich sagen: SRS-Unfälle sind ein erhebliches Problem im deutschen Arbeitsalltag und machen einen beträchtlichen Teil der Arbeitsunfälle aus. Die DGUV bietet detaillierte Statistiken und Grafiken zu Arbeitsunfällen, einschließlich SRS-Unfällen, die für die Präventionsarbeit genutzt werden können.

Bewertung der Rutschgefahr unter Betriebsbedingungen
Die Arbeitsstättenverordnung [1] fordert, dass Fußböden u. a. rutschhemmend ausgeführt sein müssen. Die Arbeitsstättenregel, ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ [2] konkretisiert diese Forderung und verweist dabei auf die Gefährdungsbeurteilung, die vom Arbeitgeber durchzuführen ist. Diese DGUV Information dient zur Bewertung der Rutschgefahr unter betrieblichen
Bedingungen durch Prüfung der Rutschhemmung.
Rutschunfälle - Weitere Ergebnisse
Leider geschehen auch immer wieder tödliche Arbeitsunfälle, die auf Rutschen oder Stolpern zurückzuführen sind. Einige Branchen haben hierbei eine besonders hohe Gefahrenlage.
Regelungen für Antirutsch in Deutschland für Unternehmen
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) ist die zentrale Organisation für die gesetzliche Unfallversicherung in Deutschland. Ihre Regeln und Vorschriften, insbesondere die zur Verhinderung von Rutschunfällen, sind darauf ausgelegt, die Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhöhen und Unfälle zu minimieren. Die DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) hat Vorschriften und Regelungen zur Vermeidung von Unfällen durch Rutschen. Diese Vorschriften beziehen sich auf die Gestaltung von Arbeitsplätzen, die Auswahl geeigneter Materialien, die Schulung der Mitarbeiter und die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen.
Ein wichtiger Punkt ist die Sicherstellung von rutschfesten Oberflächen in Bereichen, in denen das Risiko des Rutschens besteht, wie beispielsweise in Produktionsstätten, Lagerhäusern oder auf Baustellen. Auch das richtige Verhalten der Mitarbeiter, wie das Tragen geeigneter Schuhe und das Befolgen sicherheitsrelevanter Anweisungen, spielt eine entscheidende Rolle. Die DGUV stellt auch Informationen und Handlungshilfen zur Verfügung, um Arbeitgeber und Arbeitnehmer über Maßnahmen zur Unfallvermeidung aufzuklären. Es ist empfehlenswert, die spezifischen DGUV-Vorschriften und -Regelungen zu konsultieren, um detaillierte Informationen zu erhalten.

DGUV-Regel 108-003
Hier können Sie die DGUV-Regel 108-003 zur Sicherheit vor Rutschunfällen herunterladen. In der DGUV-Regel finden Sie die genauen Vorgaben für die Rutschhemmungsklasse (R9 bis R13), die eine Antirutschbeschichtung in unterschiedlichen Branchen und Anwendungsfällen aufweisen muss.
Rechtliche Grundlage
Risikobewertung
Präventive Maßnahmen
Dokumentation und Nachweis
Schulungen
DGUV Vorschriften und DGUV Regeln - Was ist der Unterschied?

Regelungen, Richtlinien und Vorschriften International
In den europäischen und internationalen Ländern gibt es verbindliche Regeln und Vorschriften zur Vermeidung von Unfällen durch Rutschen, die in verschiedenen Rechtsvorschriften und Normen festgelegt sind. Diese Vorschriften sind häufig Teil der allgemeinen Arbeitsschutzgesetze und -richtlinien, die darauf abzielen, ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten.
EU Richtlinien zum Schutz vor Unfällen durch Rutschen
Auf europäischer Ebene gibt es keine einzelne Richtlinie, die sich ausschließlich mit der Prävention von Unfällen durch Rutschen befasst. Stattdessen sind die grundlegenden Schutzmaßnahmen in einem übergeordneten rechtlichen Rahmenwerk verankert, das die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, nationale Gesetze zu erlassen und umzusetzen.
Die wichtigste Grundlage ist die EG-Arbeitsschutz-Rahmenrichtlinie (Richtlinie 89/391/EWG).
Die EG-Arbeitsschutz-Rahmenrichtlinie (89/391/EWG)
Diese Richtlinie legt die grundlegenden Prinzipien für die Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in der gesamten Europäischen Union fest. Sie ist der "Überbau" für alle nationalen Arbeitsschutzgesetze (wie das deutsche Arbeitsschutzgesetz).
Wichtige Prinzipien, die sich auch auf die Rutschsicherheit beziehen, sind:
- Pflicht zur Gefahrenbeurteilung: Die Richtlinie verpflichtet Arbeitgeber, alle Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz zu beurteilen und zu dokumentieren. Dazu gehört auch die Identifizierung von Gefahren, die zu Rutsch-, Stolper- und Sturzunfällen führen können.
- Grundsatz der Prävention: Arbeitgeber müssen Gefahren an der Quelle bekämpfen, also präventiv handeln. Die Richtlinie setzt eine Hierarchie der Präventionsmaßnahmen fest:
- Pflicht zur Unterweisung der Beschäftigten: Arbeitgeber sind verpflichtet, die Beschäftigten über alle Gefahren am Arbeitsplatz zu informieren und sie entsprechend zu unterweisen.
Konkretisierung durch weitere Richtlinien und nationale Gesetze
Die Rahmenrichtlinie wird durch spezifischere Einzelrichtlinien ergänzt. Beispielsweise verlangt die Arbeitsstättenrichtlinie (Richtlinie 89/654/EWG) von den Mitgliedstaaten, dass Arbeitsstätten den Sicherheitsanforderungen genügen. Dazu gehört die Vorgabe, dass Fußböden stabil, eben, ohne gefährliche Löcher oder Schrägen und nicht rutschig sein dürfen.
Diese EU-Richtlinien werden dann von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt. In Deutschland geschieht dies durch Gesetze wie das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) wie die ASR A1.5 "Fußböden". Diese nationalen Vorschriften machen die EU-Vorgaben konkret und geben detaillierte Anweisungen zur Auswahl der richtigen Bodenbeläge und zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen.
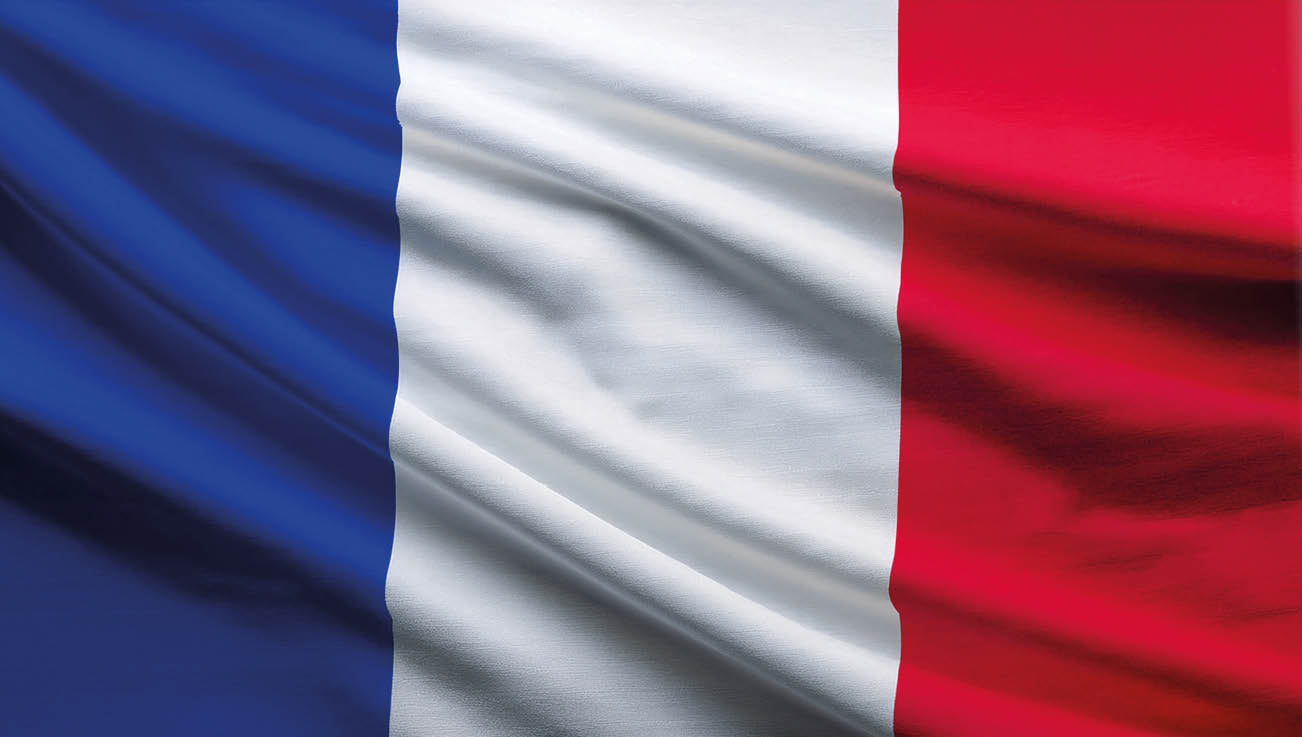
Beispiel Frankreich
In Frankreich gibt es mehrere Vorschriften und Regelungen zur Vermeidung von Unfällen durch Rutschen, die sich auf die Sicherheit am Arbeitsplatz konzentrieren. Hier sind einige der wichtigsten Aspekte:
Messung der Rutschhemmung
In den Ländern wird die Rutschhemmung auf unterschiedliche Art und Weise gemessen. Gemeinsam haben die Verfahren, dass sie genormt sind und einem Standard entsprechen, der eine Vergleichbarkeit der Produkte zulässt. Die Vorschriften und Regelungen der unterschiedlichen Länder bezüglich des Schutzes vor S-R-S-Unfällen beziehen sich auf die national oder international gültigen Messverfahren. So werden in Deutschland die Regeln der DGUV nach den in Deutschland gültigen Einteilungen - von R9 bis R13 - formuliert. Der Ablauf zur Bestimmung der Rutschhemmungsklassen erfolgt in Deutschland streng reglementiert und wird in der DIN-Vorschrift DIN 51130 festgehalten. Antirutsch-Produkte können sich diesem Verfahren unterziehen und erhalten bei Bestehen der Tests eine Zertifizierung.
Unsere Produkte Protec R13 One und Protec R13 Two sind nach DIN 51130 für die höchste Rutschhemmungsklasse R13 zertifiziert.
Messverfahren der Rutschhemmung - National und International
Vorschriften, Regelwerke
Hier finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Gesetze, Vorschriften und Regeln.
Gesetze, Verordnungen
Technisches Regelwerk zu den Arbeitsschutzverordnungen
Berufsgenossenschaftliche vorschriften









